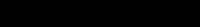PORTLAND
Bilder der Ausstellung
Beschreibung
Wie wird das Künstlerdasein von einer Generation an die nächste weitergegeben? Man denkt an die vielen Künstlerväter und -söhne in der langen Geschichte der Kunst (Künstlermütter und -töchter fallen einem bezeichnenderweise nicht ein): in der alten Kunst z. B. an Raffael und seinen Vater Giovanni Santi oder an Pieter Brueghel und seine Söhne Jan und Pieter. Aber auch in der Moderne finden sich zahlreiche Beispiele: Wilhelm und Franz Marc, Alexej und Andreas Jawlensky oder Lyonel Feininger und seine Söhne Andreas und Lux. Nennen könnte man auch Willi Geiger (übrigens nahe Landshut geboren) und seinen Sohn Rupprecht sowie dessen Söhne Lenz und Florian. Zum Künstlerdasein ermutigt hat Willi Geiger übrigens seine Mutter. Und auch die Urenkelin Nanda, eine Fotografin, sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben – denn nichts geschieht ganz ohne die Frauen.
Verfolgen Künstlerväter und -söhne vergleichbare künstlerische Ziele? Verbinden sich ihre künstlerischen Verfahren? Darauf gibt es für jeden einzelnen Fall sicher individuelle Antworten. In der gemeinsamen Ausstellung von Josef und Michael Sailstorfer aber besteht die Gelegenheit, ihre – unabhängig voneinander entstandenen – Werke genauer anzuschauen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede unmittelbar abzulesen. Dabei ist schon der für die gemeinsame Ausstellung gewählte Titel aufschlussreich: Denn unter dem Namen „Portland“ wurde im 19. Jahrhundert ein wichtiges Bindemittel bekannt: der Zement – Bestandteil von Beton, Mörtel und Estrich. Ein englischer Maurer war es, der sich den Baustoff patentieren ließ, der durch Mischen und Erhitzen von Ton und Kalk entstand und durch die Zugabe von Wasser einen Zementleim schuf, der schnell trocknete und steinhart wurde. Der neue Kunststein erinnerte den Erfinder an die grauen Kalksteingebilde auf der südenglischen Halbinsel Portland, deshalb nannte er ihn „Portlandzement“.
Der Ausstellungstitel „Portland“ könnte also in einem übergeordneten Sinne einen Stoff meinen, der die Dinge zusammenhält: Familienbande, aber auch das Interesse an Kontexten, am plastischen Arbeiten. Denn eines ist klar, was die Künstler Josef und Michael Sailstorfer verbindet: Die beiden sind Bildhauer – also Künstler, für die das Volumen, das Körperliche, die Physis der Dinge, Fragen des Raums, Materials, des Gewichts wichtig sind – und Standpunkte, von Objekten ebenso wie den der Betrachtenden, als Gegenüber und gleichrangige Partner.
Wer ihre einzelnen Arbeiten anschaut, spürt aber auch, dass die gedanklichen Wege zu den Werken und der Umgang mit den Materialien unterschiedlich sind. Um es gleich vorwegzunehmen: Während es dem Vater Josef Sailstorfer um Bewegung geht, um den Möglichkeitsraum des Stofflichen oder des Gebauten, zielt Sohn Michael Sailstorfer darauf ab, das Leichte und Flüchtige zu erden, es zu binden und das Potenzial des Materiellen über sinnliche und emotionale Momente zugänglich zu machen. Dazu gleich mehr.
Der klassische Portlandzement ist ein wichtiges Arbeitsmaterial von Josef Sailstorfer. Seit Jahrzehnten dient er ihm dazu, eine ganz bestimmte Oberflächenqualität herzustellen, die einem zweidimensionalen Bild eine physisch-haptische Ausstrahlung verleiht. Wie ein Maler experimentiert Sailstorfer mit diesem Material, oft färbt er die Masse ein, bevor er sie auf Holzplatten aufbringt und minimale, minimalistische Kompositionen entstehen lässt.
Ausgangspunkt ist dabei immer eine architektonische, eine gebaute Vorstellung, ein konstruktives Gebilde, ein geometrischer Körper. Diesem Vokabular, dem Fundus des Architektonischen und Räumlichen, entnimmt der Künstler einzelne Motive, er wählt gewissermaßen Situationen aus, konzentriert sich auf Teilaspekte, Details, die das ursprünglich große Ganze ausblenden und in einen imaginierten Bereich transponieren: Formen, die an Treppen erinnern, an Sockel, Vor- und Versprünge, Fassadenteile.
Sichtbar wird jeweils ein Momentum, ein Ausschnitt des Konstruktiven, lediglich der Eindruck des Architektonischen, manchmal verfremdend wie eine fotografische Nahaufnahme, die gleichermaßen abstrahiert und einen – in einer großen, fast meditativen Ruhe – die Dinge neu sehen, ihre Verbindungen neu ordnen lässt. Dabei ist diese Angelegenheit nie statisch. Denn manche Zementbilder lassen sich auch als Abdrücke verstehen, die dreidimensionale Skulpturen hinterlassen haben, sie könnten auch materialisierte Schatten von Objekten sein. Das Zweidimensionale wirkt wie eine Spur, der Rest des Dreidimensionalen. Dadurch entsteht eine Leichtigkeit, eine Beweglichkeit des vormals Schweren und Unbeweglichen.
Eine vergleichbare Transformation erfährt auch die Bronzestele, die im Außenraum steht. Josef Sailstorfers lässt dort einen zierlichen Pfeiler, eigentlich ein stabiles architektonisches Element, sich aus seinem quadratischen Grundriss in die Höhe schrauben. Ausgehend von einer Grundfläche, einem zweidimensionalen Standpunkt entwickelt er eine geschmeidige Drehbewegung nach oben. Die bildhauerische Welt des Josef Sailstorfer ist ein Spiel mit der Starrheit, seine Arbeiten versetzen die vermeintliche Festigkeit der konstruktiven Welt in Schwingung, indem der Künstler deren Bestandteile, ihre Elemente aus der Verankerung löst, dreht, kippt und neu ausbalanciert.
Genau an dieser Stelle setzt Michael Sailstorfer an. Sein Ausgangspunkt scheint gerade der instabile Raum zu sein, das Flüchtige, Bewegliche und auch Unverbindliche, das unsere Welt heute und immer stärker prägt. Auf ebenso spielerische Weise wie der Vater agiert auch der Sohn, doch im Unterschied zu ihm bietet Michael Sailstorfer seinen Skulpturen neuen Halt – eine Rückbindung an die Welt, vielleicht eine Art Rückversicherung, eine Bestätigung durch eine veränderte, bisweilen humorvolle Auffassung von Körperlichkeit.
Wenn er zum Beispiel zwei luftgefüllte LKW-Schläuche ineinandersteckt und in Bronze abgießt, dann werden die ehemals leichten Objekte mit ihrer volatilen Energie zu einem einzigen Körper – prall, physisch, symbiotisch ineinander verknäult. Diese neue, fast laszive, fetischhafte Einheit kann nicht mehr platzen, hat eine bequeme Lagerposition am Boden gefunden. „Very Heavy Cloud“ nennt Michael Sailstorfer seine Skulptur, in der sich die assoziierten Gewichte vertauscht haben. Die ungreifbare „Wolke“ hat nun eine Schwere bekommen. Das lässt durchaus mit den Daten-Clouds in Verbindung bringen, die trotz ihrer Immaterialität durchaus belastend wirken können.
„Heavy“ sind auch die Wandarbeiten von Michael Sailstorfer, „Heavy Eyes“ lautet ihr (Serien-)Titel. Es sind Arbeiten aus Blei – dünn gewalzten, weichen Bleischichten aus dem Dachdeckerbedarf, die durch die rechteckige Formatwahl zu Bildträgern werden. Die Oberflächen sehen unterschiedlich aus, haben sich je nach Lagerung verändert, etwa durch Feuchtigkeit Oxydationsprozesse erlebt, die mit malerischen Farbveränderungen einhergingen. Auf diese individuellen Oberflächen reagiert Michael, bearbeitet sie mit Lidschatten in jeweils unterschiedlichen Tönen (die Farben ergänzen den Titel der Serie), den er sorgfältig aufträgt, was manchmal lange Zeit in Anspruch nimmt. Das Gestische der Materialspuren und das Gestische des gestalteten Eingriffs nähern einander an.
Ebenso wie die „Clouds“ erzeugen auch die „Eyes“ eine eigentümliche Körperlichkeit nur anders. Sie wirken an der Wand wie ein Gegenüber, wie Gesichter, und vermitteln einen emotionalen Gemütszustand, der in der Asymmetrie von metallischer, visuell „schwerer“ Oberfläche und zartem Farbpuder eine gewisse Melancholie spürbar werden lässt. Diese Bilder schauen uns an (und wir sie) – und wir werden des Gewichts der irdischen Welt, der „Fracht“ des Lebens, der Symptome des Vergänglichen gewahr. Das Bewusstsein für unsere vergeblichen Versuche, uns gegen diese unvermeidlichen Aspekte unseres kleinen Daseins zu stemmen, verleihen diesen Bildern etwas ungemein Menschliches.
Eine weitere Arbeit von Michael Sailstorfer zeigt eine in Bronze gegossene Glühbirne, deren Form zunächst aus Wachs bestand und von Bienen in ihrem Stock weiterbearbeitet worden war. Dies lässt die Vermutung zu, dass es auch in Michael Sailstorfers Skulpturen immer um Energie geht, die in der Kunst einen Speicher findet – und sie darf als Hommage an Joseph Beuys verstanden werden, der die Kultur immer in einem untrennbaren Verhältnis zur Natur gesehen hat.
Wer weiß, wie Menschen künftiger Generationen auf unsere Epoche zurückblicken werden! Vielleicht wird der Beginn des 21. Jahrhunderts später einmal als das Zeitalter erinnert werden, in dem wir uns auf neue Weise der Fragilität unserer Existenz, unserer Gefährdung als Menschen bewusst wurden. Eine Epoche, in der durch die fortschreitende Digitalisierung eine überbordende elektronische Kommunikation entstand, kontaktlose Begegnungen normal und virtuelle Zusammenkünfte – pandemisch bedingt – verordnet wurden. In diesem Heute kommt die Ausstellung „Portland“ gerade richtig. Sie schenkt uns haptische Oberflächenreize und spielerische Verdrehungen, die in unseren Köpfen etwas bewegen und uns von jeder Starrheit befreien. Sie schenkt uns eine Poesie, die unserem Alltag oft fehlt oder zu selten bewusst wird. Diese Ausstellung macht deutlich, was in unserer Welt niemals fehlen darf: die Kunst.
Bernhart Schwenk
Diese Ausstellung wird von der Stiftung Kunstfonds als Teil des Programms NEUSTART KULTUR gefördert.